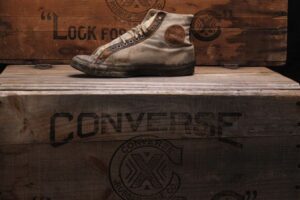EU zieht Konsequenzen aus Paketflut
Die Europäische Union will den unkontrollierten Zustrom günstiger Waren aus China eindämmen. Auf Initiative der EU-Kommission haben sich die Finanzminister der Mitgliedsstaaten darauf geeinigt, die bislang geltende Zollfreigrenze von 150 Euro für Direktimporte aus Drittstaaten abzuschaffen. Künftig sollen auch günstige Bestellungen bei Online-Plattformen wie Shein, Temu oder AliExpress zollpflichtig werden – möglicherweise schon ab Ende 2026, spätestens jedoch 2028.
„Wir wollen keine Ramschware aus China – wir wollen unsere Märkte schützen“, betonte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) nach dem Treffen in Brüssel.
Reaktion auf wachsende Kritik und Paketflut
Der Beschluss ist eine Antwort auf den enormen Anstieg von Billigsendungen vor allem aus China. Täglich erreichen laut EU-Kommission rund zwölf Millionen Kleinsendungen die Europäische Union – davon allein etwa 400.000 Pakete nach Deutschland, meist von Shein und Temu. Die beiden Plattformen erzielten hierzulande 2024 zusammen einen Umsatz zwischen 2,7 und 3,3 Milliarden Euro. Rund 14 Millionen Deutsche kauften im vergangenen Jahr bei einem der beiden Anbieter ein.
Bisher konnten Waren unter 150 Euro zollfrei eingeführt werden. Diese Regelung wurde zunehmend als Einfallstor für Wettbewerbsverzerrung und Betrug kritisiert. Nach Schätzungen der EU-Kommission wird bei rund 65 Prozent der Pakete der Warenwert zu niedrig angegeben, um Zölle zu umgehen. „Es ist höchste Zeit, die Flut billiger chinesischer Pakete in den Griff zu bekommen“, sagte der niederländische Finanzminister Eelco Heinen.
Fairer Wettbewerb als Ziel
Mit der neuen Regelung will die EU sicherstellen, dass alle Händler – unabhängig von ihrem Standort – unter den gleichen Wettbewerbsbedingungen agieren. Während europäische Unternehmen Steuern, Umwelt- und Verbraucherschutzauflagen einhalten müssen, umgehen viele Billigplattformen diese Standards durch Direktlieferungen an Verbraucher.
Auch Verbraucherschützer begrüßen die Einigung. „Die Abschaffung der Zollfreigrenze ist ein erster Baustein, um die Paketflut einzudämmen“, erklärte Ramona Pop, Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Sie forderte zugleich, Online-Marktplätze stärker in die Verantwortung zu nehmen, wenn sie unsichere oder nicht EU-konforme Produkte vertreiben. Eine Untersuchung der Stiftung Warentest zeigte zuletzt, dass über zwei Drittel der getesteten Billigprodukte aus Asien nicht den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen.
Handelsverband spricht von „Sabotage am Binnenmarkt“
Während Brüssel handelt, wächst in Deutschland der Druck auf die Bundesregierung. Der Handelsverband HDE wirft Berlin Untätigkeit gegenüber Shein und Temu vor. „Shein und Temu unterlaufen täglich systematisch europäische Verbraucher-, Steuer- und Umweltstandards – das ist Sabotage am Binnenmarkt“, kritisierte Alexander von Preen, Präsident des Handelsverbands Deutschland.
Auch aus dem Mittelstand kommen klare Forderungen. ZGV-Präsident Günter Althaus sprach von einem „überfälligen Schritt hin zu fairem Wettbewerb in Europa“, mahnte jedoch an, die Zollämter müssten personell und digital besser ausgestattet werden, „damit sie den wachsenden Warenverkehr tatsächlich kontrollieren können“.
Digitalisierung der Zollkontrolle entscheidend
Die Umsetzung der Maßnahme ist anspruchsvoll: Die Zollbehörden stehen bereits heute unter Druck. Alien Mulyk, Geschäftsführerin Public Affairs Europa & International, warnt deshalb vor einer bloßen Symbolpolitik: „Die Abschaffung der Zollfreigrenze ist ein wichtiger erster Schritt für fairere Wettbewerbsbedingungen. Damit die Maßnahme wirken kann, braucht es aber eine schnellstmögliche Digitalisierung, eine bessere Ausstattung der Zoll- und Marktüberwachungsbehörden sowie ein einheitliches System im Binnenmarkt.“
Tatsächlich soll eine digitale Plattform zur Erfassung und Kontrolle von Kleinsendungen erst 2028 vollständig einsatzbereit sein. Um den Druck aus der Praxis zu nehmen, wollen die Mitgliedstaaten bereits im kommenden Jahr eine Übergangslösung einführen. Diskutiert wird zudem eine pauschale Bearbeitungsgebühr von zwei Euro pro Paket, um zusätzliche Verwaltungskosten abzudecken.