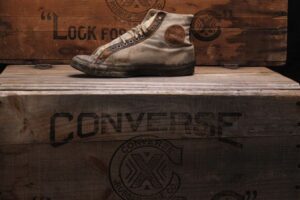Wie die Modebranche Milliarden aus Alttextilien zurückgewinnen könnte
Jahr für Jahr landen weltweit rund 120 Millionen Tonnen Kleidung im Müll – genug, um mehr als 200 Fußballstadien bis zum Rand zu füllen. Viele dieser Stücke wurden kaum getragen: Im Schnitt wechseln Konsumenten ein Kleidungsstück nach nur sieben bis zehn Einsätzen in die Altkleidersammlung oder entsorgen es direkt. Das Ergebnis sind wachsende Müllberge, die in Regionen wie der Atacama-Wüste in Chile inzwischen so groß sind, dass sie sogar aus dem All zu sehen sind.
Laut einer aktuellen Analyse der Boston Consulting Group (BCG) summiert sich der ungenutzte Rohstoffwert dieser Alttextilien auf rund 150 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Würde es gelingen, das Recycling im industriellen Maßstab zu etablieren, könnten über 50 Milliarden US-Dollar davon in Form neuer Fasern zurückgewonnen und bis zu 180.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Die Ursachen: Mehr kaufen, kürzer tragen
Seit dem Jahr 2000 hat sich die weltweite Faserproduktion mehr als verdoppelt – mit entsprechendem Anstieg beim Ressourcenverbrauch und beim Abfallaufkommen. Über 90 Prozent der CO₂-Emissionen der Modebranche entstehen bei der Gewinnung und Verarbeitung neuer Rohstoffe. Hinzu kommen Emissionen aus der Verbrennung oder Deponierung ausgedienter Textilien sowie Mikroplastikbelastungen durch offen gelagerte synthetische Fasern.
Ein weiteres Problem: Viele Altkleider werden in ärmere Länder exportiert, wo sie mangels Recyclinginfrastruktur ebenfalls auf riesigen Müllhalden enden – und lokale Märkte für Textilprodukte unter Druck setzen.
Der regulatorische Druck wächst
Die Politik reagiert: In der EU gehören Textilien zu den fünf Konsumgüterkategorien mit den größten Klimaauswirkungen. Neue Regelungen wie die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) verpflichten Marken und Händler dazu, für die Rücknahme und das Recycling ihrer Produkte zu sorgen. Ähnliche Initiativen entstehen in den USA, Kanada und Chile.
Parallel beginnen erste Unternehmen wie Adidas, New Balance und Puma, in textile Kreislaufprojekte zu investieren. Prognosen zufolge wird die Nachfrage nach recycelten Fasern bis 2030 das Angebot um 30 bis 40 Millionen Tonnen übersteigen – ein starkes Signal für wirtschaftliches Potenzial.
Die größten Hürden
Trotz des wachsenden Bewusstseins bleibt die Recyclingquote niedrig – aktuell werden nur 7 Prozent des Textilabfalls überhaupt als Rohstoffquelle genutzt, und daraus entsteht weniger als 1 Prozent neuer Fasern. Die Gründe:
- Kosten und Qualität – Recycelte Materialien sind oft teurer und schwerer in bestehende Produktionsketten zu integrieren.
- Unzureichende Infrastruktur – Sammel- und Sortiersysteme sind vielerorts auf Wiederverkauf, nicht auf Recycling ausgelegt.
- Technische Grenzen – Mischgewebe aus Natur- und Kunstfasern lassen sich mit heutigen Verfahren nur schwer trennen.
Fünf Hebel für die Wende
BCG empfiehlt einen Maßnahmenmix, um die Textilkreislaufwirtschaft voranzubringen:
- Nachfrage fördern: Marken sollten gemeinsam den Absatz recycelter Fasern steigern.
- Sammelsysteme ausbauen: Öffentliche und private Initiativen zur flächendeckenden Erfassung.
- Sortierung modernisieren: Automatisierte Verfahren mit KI- und Nahinfrarot-Technik für präzisere Materialtrennung.
- Recyclinglösungen skalieren: Ausbau industrieller Kapazitäten und Einsatz neuer Technologien wie chemisches Recycling.
- Innovation finanzieren: Kooperationen zwischen Marken, Produzenten und Investoren, um Verfahren zur Marktreife zu bringen.
Ein Blick in andere Branchen zeigt, dass Transformation möglich ist: Das deutsche Pfandsystem erzielt Rücklaufquoten von 98 Prozent, und die Kosten für Solarenergie sanken binnen zehn Jahren durch koordinierte Investitionen um 89 Prozent.