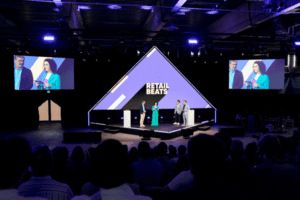Stationärer Handel unter Druck – Online legt weiter zu
Der deutsche Schuhhandel blickt auf ein schwieriges erstes Halbjahr 2025 zurück. Nach ersten Hochrechnungen des BTE Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren sank der Umsatz im Durchschnitt um drei bis vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes bestätigen die Entwicklung: In allen sechs Monaten wurden Umsatzrückgänge im einstelligen Bereich verzeichnet, einzig der März erreichte annähernd das Vorjahresniveau.
Online-Handel im Aufwind
Anders stellt sich die Lage im Internet dar. Laut einer repräsentativen Verbraucherbefragung des E-Commerce-Verbands bevh stiegen die Ausgaben für Schuhe im Online-Handel im ersten Quartal 2025 um 5,8 Prozent, im zweiten Quartal sogar um 7,6 Prozent. „Viele Konsumenten haben sich während der Corona-Zeit an den Online-Kauf und die Informationssuche im Netz gewöhnt. Zudem ist die Angebotsqualität deutlich gestiegen“, erklärte BTE-Schuh-Experte Sönke Padberg anlässlich der Messe Twodays in Düsseldorf.
Ein weiterer Faktor ist die Sortimentsentwicklung im Modehandel. Bekleidungsanbieter integrieren zunehmend Schuhe in ihr Angebot, um Outfits zu komplettieren. Dies verstärkt den Druck auf klassische Schuhfachgeschäfte, die sich damit in einem härter werdenden Wettbewerbsumfeld behaupten müssen.
Nervosität bei Händlern und Lieferanten
Padberg schildert eine „spürbare Nervosität“ im Markt: „Es ist keine klare Haltung erkennbar, auch wenn man jetzt mit den Lieferanten spricht. Das Orderverhalten ist gedämpft und von Unsicherheit geprägt.“ Viele Händler hätten ein schwieriges erstes Halbjahr hinter sich. Zugleich gebe es aber rund 20 Prozent, die ihre Ziele erreichten und sogar im Plus lagen. „Diese Händler haben oft für sich ein kuratiertes Sortiment gefunden. Darin liegt eine Chance: Wer den Warenkorb sinnvoll erweitert und sein Profil schärft, kann Zusatzverkäufe generieren.“
Als Hauptursache für die schwache Umsatzentwicklung sieht der BTE die anhaltende Insolvenz- und Schließungswelle. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein traditionsreiches Schuhgeschäft seine Türen dauerhaft schließt. Selbst in mittelgroßen Städten fehlt mittlerweile oft ein Schuhhaus mit breitem Markensortiment und fachkundiger Beratung. Viele Kunden weichen deshalb ins Internet aus – oder orientieren sich an anderen Vertriebskanälen.
Die Zahl der Schuhfachhändler ist in den vergangenen 15 Jahren dramatisch gesunken. Nach Schätzungen des BTE verkaufen aktuell nur noch rund 2.500 Unternehmen schwerpunktmäßig Schuhe in Deutschland. 2010 waren es laut Umsatzsteuerstatistik noch mehr als 5.000. Auch bei Einbeziehung der Filialen ist der Rückgang erheblich: Der Gesamtbestand an stationären Schuhläden liegt inzwischen unter 8.000.
Strukturelle Ursachen
Zwei Entwicklungen gelten als zentrale Ursachen: Zum einen scheitert die Weiterführung vieler inhabergeführter Betriebe an der fehlenden Nachfolge – ein Problem, das auch andere mittelständische Branchen betrifft. Zum anderen leidet der Schuhhandel seit der Corona-Pandemie unter wirtschaftlichen Belastungen, die vielfach in die Verlustzone führen. Während die Umsätze im stationären Handel noch immer einige Prozentpunkte unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019 liegen, sind die Kosten seit 2020 um rund 30 Prozent gestiegen. „Das bringt viele Betriebe dauerhaft in die roten Zahlen“, so Padberg.
Auch die Preisentwicklung spielt eine Rolle. Während Bekleidung und Konsumgüter spürbar teurer geworden sind, haben sich die Verbraucherpreise für Schuhe in den letzten Jahren nur moderat erhöht. „Ein Polohemd ist heute 20 Euro teurer als vor fünf Jahren, ein Schuh kostet im Schnitt das Gleiche. Da stellt sich die Frage, wie sich das noch rechnen soll“, betont Padberg.
Digitalisierung als Schwachpunkt
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die digitale Transformation. „Es ist für mich unfassbar, dass der Schuhhandel immer noch nicht ausreichend digitalisiert ist“, sagt Padberg. Viele Prozesse seien veraltet, was die Branche im Wettbewerb mit anderen Handelsfeldern ins Hintertreffen bringe. Die Folge: „Wir reden von Schließungen ohne Ende. Viel gravierender als Insolvenzen sind die leisen, stillen Geschäftsaufgaben, die die Marktstruktur weiter aushöhlen.“
Trotz neuer Modetrends im Frühjahr blieb der belebende Effekt für den Schuhhandel aus. „Ich hätte mir mehr Impulskäufe erhofft. Stattdessen sehe ich vielerorts ein Überangebot an Sneakern, während andere Modelle wie Loafer oder Slingpumps kaum präsent sind“, kritisiert Padberg. Er fordert den Fachhandel auf, die Zielgruppen klarer zu definieren und Sortimente stärker zu differenzieren – sei es mit modischen Schwerpunkten oder Nahversorgungskonzepten.
Skepsis überwiegt
Entsprechend gedämpft ist die Stimmung im Markt. Laut der aktuellen „HDE-Konjunkturumfrage Sommer“ rechnen zwei Drittel der befragten Schuh- und Lederwarenhändler 2025 mit einem weiteren Umsatzrückgang. Nur knapp jeder Fünfte erwartet einen Zuwachs. Als größte Belastungsfaktoren werden die Kaufzurückhaltung der Kunden (78 Prozent), die zunehmende Bürokratie (63 Prozent) sowie Mindestlohn und Attraktivitätsverlust der Innenstädte (jeweils 51 Prozent) genannt.
Im Jahr 2024 summierten sich die Umsätze mit Schuhen in Deutschland auf 11,62 Milliarden Euro (inklusive Mehrwertsteuer) – ein Minus von 0,8 Prozent gegenüber 2023. Besonders betroffen war der stationäre Schuhfachhandel, der rund 100 Millionen Euro bzw. 1,5 Prozent verlor. Der Online-Handel konnte dagegen um 20 Millionen Euro bzw. 0,7 Prozent zulegen.